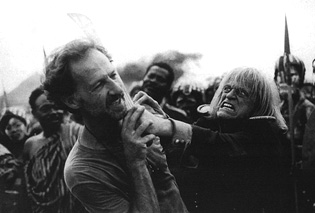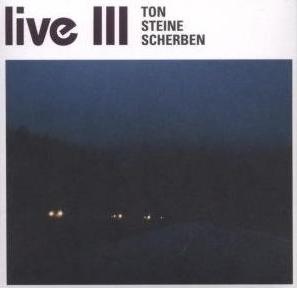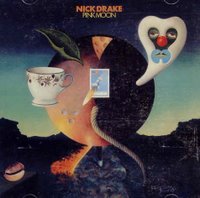Als Beitrag zur aktuellen Debatte über die Prekarisierung der deutschen Gesellschaft, ange- stoßen durch den SPD- Vorsitzenden Kurt Beck und unterstützt durch die aktuelle
Studie der Friedrich-Ebert- Stiftung, die eine zunehmende Spaltung der Gesellschaft konstatiert und 4% der West- und 25% der Ostdeutschen zum sog. "abgehängten Prekariat" rechnet, hier ein Auschnitt aus einem Text des 2002 verstorbenen französischen Soziologen Pierre Bourdieu für alle, die etwas mehr Zeit für dieses spannende und wichtige Thema mitbringen:
„(…) Es ist deutlich geworden, dass Prekarität heutzutage allgegenwärtig ist. Im privaten, aber auch im öffentlichen Sektor, wo sich die Zahl der befristeten Beschäftigungsverhältnisse und Teilzeitstellen vervielfacht hat; in den Industrieunternehmen, aber auch in den Einrichtungen der Produktion und Verbreitung von Kultur, dem Bildungswesen, dem Journalismus, den Medien usw. Beinahe überall hat sie identische Wirkungen gezeigt, die im Extremfall der Arbeitslosen besonders deutlich zutage treten: die Destrukturierung des unter anderem seiner zeitlichen Strukturen beraubten Daseins und der daraus resultierende Verfall jeglichen Verhältnisses zur Welt, zu Raum und Zeit. Prekarität hat bei dem, der sie erleidet, tief greifende Auswirkungen. Indem sie die Zukunft überhaupt im Ungewissen läßt, verwehrt sie den Betroffenen gleichzeitig jede rationale Vorwegnahme der Zukunft und vor allem jenes Mindestmaß an Hoffnung und Glauben an die Zukunft, das für eine vor allem kollektive Auflehnung gegen eine noch so unerträgliche Gegenwart notwendig ist.
Zu diesen Folgen der Prekarität für die direkt Betroffenen gesellen sich die Auswirkungen auf die von ihr dem Anschein nach Verschonten. Doch sie läßt sich niemals vergessen; sie ist zu jedem Zeitpunkt in allen Köpfen präsent (ausgenommen den Köpfen der liberalen Ökonomen, vielleicht deshalb, weil sie – wie einer ihrer theoretischen Gegner bemerkte – von dieser Art Protektionismus profitieren, den ihnen ihre tenure, ihre Beamtenstellung verschafft und die sie der Unsicherheit entreißt). Weder dem Bewußtsein noch dem Unterbewußten läßt sie jemals Ruhe. Die Existenz einer beträchtlichen Reservearmee, die man aufgrund der Überproduktion von Diplomen längst nicht mehr nur auf den Qualifikationsebenen findet, flößt jedem Arbeitnehmer das Gefühl ein, daß er keineswegs unersetzbar ist und seine Arbeit, seine Stelle gewisser Maßen ein Privileg darstellt, freilich ein zerbrechliches und bedrohtes Privileg (daran erinnern ihn zumindest seine Arbeitgeber bei der geringsten Verfehlung und die Journalisten und Kommentatoren jeglicher Art beim nächsten Streik). Die objektive Unsicherheit bewirkt eine allgemeine subjektive Unsicherheit, welche heutzutage mitten in einer hoch entwickelten Volkswirtschaft sämtliche Arbeitnehmer, einschließlich derjenigen unter ihnen in Mitleidenschaft zieht, die gar nicht oder noch nicht direkt von ihr betroffen sind. Diese Art »kollektive Mentalität« (ich gebrauche diesen Begriff hier zum besseren Verständnis, obwohl ich ihn eigentlich nicht gern verwende), die der gesamten Epoche gemein ist, bildet die Ursache für die Demoralisierung und Demobilisierung, die man in den unterentwickelten Ländern beobachten kann (wozu ich in den 60er Jahren in Algerien die Gelegenheit hatte), die unter sehr hohen Arbeitslosen- und Unterbeschäftigungsraten leiden und permanent von der Angst vor Arbeitslosigkeit beherrscht werden.
Arbeitslose und Arbeitnehmer, die sich in einer prekären Lage befinden, lassen sich kaum mobilisieren, da sie die Fähigkeit, Zukunftsprojekte zu entwerfen, beeinträchtigt sind. Das ist jedoch die Voraussetzung für jegliches so genanntes rationales Verhalten, angefangen beim ökonomischen Kalkül oder, in einem völlig anderen Bereich, der politischen Organisation. Paradoxer Weise muß man – wie ich in meinem frühesten und vielleicht zugleich aktuellsten Buch über Arbeit und Arbeiter in Algerien gezeigt habe – wenigstens ein Minimum an Gestaltungsmacht über die Gegenwart haben, um ein revolutionäres Projekt entwerfen zu können, denn letzteres ist immer ein durchdachtes Bestreben, die Gegenwart unter Bezugnahme auf ein Zukunftsprojekt zu verändern. Im Unterschied zum Subproletariat verfügt der Proletarier über dieses Minimum an Gewißheit und Sicherheit, das die Grundvoraussetzung dafür ist, überhaupt die Idee in Betracht zu ziehen, die Gegenwart unter Bezug auf eine erhoffte Zukunft umzugestalten. Doch nebenbei bemerkt ist er eben auch jemand, der immerhin auch noch etwas zu verteidigen, etwas zu verlieren hat, nämlich seine auch noch so auszehrende und unterbezahlte Stelle, und viele seiner manchmal als allzu vorsichtig oder konservativ beschriebenen Verhaltensweisen rühren von der Furcht her, wieder ins Subproletariat zurückzufallen.
Wenn Arbeitslosigkeit heute in zahlreichen Ländern Europas so hohe Raten erreicht und Prekarisierung einen großen Teil der Bevölkerung, Arbeiter, Angestellte in Handel und Industrie, aber auch Journalisten, Lehrer und Studenten erfaßt, dann wird Arbeit zu einem raren Gut, das man sich um jeden Preis herbeisehnt und das die Arbeitnehmer auf Gedeih und Verderb den Arbeitgebern ausliefert, welche dann auch die ihnen auf diese Weise gegebene Macht, wie man Tag für Tag sehen kann, gebührlich gebrauchen bzw. mißbrauchen. Die Konkurrenz um die Arbeit geht einher mit einer Konkurrenz bei der Arbeit, die jedoch auch nur eine andere Form der Konkurrenz um die Arbeit ist, ein Arbeit, die man, mitunter um jeden Preis, gegen die Erpressung mit der angedrohten Entlassung bewahren muß. Aufgrund dieser Konkurrenz, die mitunter genauso rüde ist wie diejenige der Unternehmen untereinander, kommt es zu einem regelrechten Kampf aller gegen alle, der sämtliche Werte der Solidarität und Menschlichkeit zunichte macht, manchmal aber auch zu wortloser Gewalt. Diejenigen, die sich über den angeblichen Zynismus, den ihrer Meinung nach Männer und Frauen unserer Epoche an den Tag legen, beklagen, sollten zumindest auch den Zusammenhang mit den ökonomischen und gesellschaftlichen Bedingungen sehen, die einen solchen Zynismus begünstigen oder erforderlich machen, ja obendrein noch belohnen. Die Prekarität hat also nicht nur direkte Auswirkungen auf die von ihr Betroffenen (die dadurch außerstande geraten, sich zu mobilisieren), sondern über die von ihr ausgelöste Furcht auch indirekte Folgen für alle anderen – eine Furcht, die im Rahmen von Prekarisierungsstrategien systematisch ausgenutzt wird, wie etwa im Falle der Einführung der viel zitierten »Flexibilität«, von der wir ja wissen, daß sie ebenso politisch wie ökonomisch motiviert ist. Man wird den Verdacht nicht los, daß Prekarität gar nicht das Produkt einer mit der ebenfalls viel zitierten »Globalisierung« gleichgesetzten ökonomischen Fatalität ist, sondern vielmehr das Produkt eines politischen Willens.
Das »flexible« Unternehmen beutet gewissermaßen ganz bewußt eine von Unsicherheit geprägte Situation aus, die von ihm noch verschärft wird. Es sucht die Kosten zu senken, aber auch diese Kostensenkung möglich zu machen, indem es Arbeitnehmer der permanenten Drohung des Arbeitsplatzverlustes aussetzt. Die gesamte Welt der materiellen und kulturellen, öffentlichen wie privaten Produktion wird auf diese Weise in einen breiten Prekarisierungsstrom hineingezogen, was sich beispielsweise an der Entterritorialisierung bzw. Standortunabhängigkeit der Unternehmen zeigen läßt: Die Verbindung, die bisher zwischen ihm und einem Nationalstaat oder einem Ort (z.B. Detroit oder Turin für die Automobilindustrie) existierte, löst sich nun zunehmend mit dem Aufkommen so genannter »Netzwerk-Unternehmen« auf, die sich durch die Verknüpfung von Produktionssegmenten, technologischem Wissen, Kommunikationsnetzwerken, sowie durch geographisch weit verzweigte Ausbildungswege über einen ganzen Kontinent oder gar den gesamten Globus erstrecken können. Durch die Erleichterung oder gar Organisierung der Kapitalmobilität und durch die »Produktionsverlagerung« in Billiglohnländer, in denen die Arbeitskosten niedriger liegen, hat man die Ausweitung der Konkurrenz zwischen den Arbeitnehmern auf Weltmaßstab möglich gemacht. An die Stelle des an einen nationalen Kontext gebundenen oder gar verstaatlichten Unternehmens, dessen Konkurrenzgebiet sich mehr oder weniger genau mit dem Staatsgebiet deckte und das sich Märkte im Ausland erkämpfte, ist das multinationale Unternehmen getreten, das die Arbeitnehmer nicht mehr nur der Konkurrenz mit ihren Landsleuten oder gar, wie Demagogen glauben machen wollen, mit den auf dem eigenen Staatsgebiet niedergelassenen Ausländern aussetzt, die ja ganz offenkundig die ersten Opfer der Prekarisierung sind, sondern in Wirklichkeit mit den zur Annahme von Elendslöhnen gezwungenen Arbeitern am anderen Ende der Welt.
Die Prekarität ist Teil einer neuartigen Herrschaftsform, die auf der Errichtung einer zum allgemeinen Dauerzustand gewordenen Unsicherheit fußt und das Ziel hat, die Arbeitnehmer zur Unterwerfung, zur Hinnahme ihrer Ausbeutung zu zwingen. Zur Kennzeichnung dieser Herrschaftsform, die, obschon sie in ihren Auswirkungen stark dem wilden Kapitalismus aus den Frühzeiten der Industrialisierung ähnelt, absolut beispiellos ist, hat jemand das treffende und aussagekräftige Konzept der Flexploitation vorgeschlagen. Dieser Begriff veranschaulicht sehr treffend den zweckrationalen Gebrauch, der von Unsicherheit gemacht wird. Indem man, besonders über eine Konzertierte Manipulation der Produktionsräume, die Konkurrenz zwischen den Arbeitnehmern in den Ländern mit den bedeutendsten sozialen Errungenschaften und der bestorganisierten gewerkschaftlichen Widerstandskraft – lauter an ein Staatsgebiet und eine nationale Geschichte gebundene Errungenschaften – und den Arbeitnehmern in den, was soziale Standards anbelangt, am wenigsten entwickelten Ländern anheizt, gelingt es dieser Unsicherheit, unter dem Deckmantel vermeintlich naturgegebener Mechanismen, die sich schon dadurch selbst rechtfertigen, die Widerstände zu brechen und Gehorsam und Unterwerfung durchzusetzen.
Die von der Prekarität bewirkten Dispositionen der Unterwerfung bilden die Voraussetzung für eine immer erfolgreichere Ausbeutung, die auf einer Spaltung zwischen einerseits der immer größer werdenden Gruppe derer, die nicht arbeiten, und andererseits, die immer mehr arbeiten, fußt. Bei dem, was man ständig als ein von den unwandelbaren »Naturgesetzen« des Gesellschaftlichen regierten Wirtschaftssystemen hinstellt, scheint es sich meines Erachtens in Wirklichkeit vielmehr um eine politische Ordnung zu handeln, die nur mittels der aktiven oder passiven Komplizenschaft der im eigentlichen Sinne politischen Mächte errichtet werden kann. Gegen diese politische Ordnung kann ein politischer Kampf geführt werden. Und er kann sich, ähnlich wie karitative oder militant-karitative Bewegungen, zunächst zum Ziel setzen, die Opfer der Ausbeutung, all die gegenwärtigen oder potentiell Prekarisierten zu ermutigen, gemeinsam gegen die zerstörerischen Kräfte der Prekarität anzugehen (indem man ihnen hilft zu leben, »durchzuhalten«, einen aufrechten Gang und Würde zu bewahren, der Zersetzung und dem Verfall ihres Selbstbildes, der Entfremdung zu widerstehen). Darüber hinaus sollten sie vor allem auch ermutigt werden, sich auf internationaler Ebene, also auf derselben Ebene, auf der auch die Folgen der Prekarisierungspolitik wirksam werden, mit dem Ziel zu mobilisieren, diese Politik zu bekämpfen und die Konkurrenz zu neutralisieren, die sie zwischen den Arbeitnehmern erzeugen will.
Der politische Kampf kann aber auch versuchen, die Arbeitnehmer der Logik früherer Kämpfe mit ihrer Forderung nach Arbeit oder besseren Arbeitslöhnen zu entreißen, weil sich diese Logik einzig und allein auf die Arbeit versteift und dadurch sozusagen die Ausbeutung (oder Flexploitation) zuläßt. An deren Stelle könnte eine Umverteilung der Arbeit (z.B. über eine massive Verkürzung der wöchentlichen Arbeitszeit auf europäischer Ebene) treten, eine Umverteilung, die untrennbar mit einer Neudefinition des Verhältnisses zwischen der Zeit der Produktion und der Zeit der Reproduktion, der Erholung und der Freizeit verknüpft wäre. Eine solche Revolution müßte mit dem Verzicht auf die ausschließlich berechnende und individualistische Sichtweise beginnen, welche den handelnden Menschen auf ein kalkulierendes Wesen reduziert, das nur mit der Lösung von Problemen rein ökonomischer Art im engsten Sinn des Wortes befaßt ist. Damit das Wirtschaftssystem funktionieren kann, müssen die Arbeitnehmer ihre eigenen Produktions- und Reproduktionsbedingungen, aber auch die Bedingungen für das funktionieren des Wirtschaftssystems selbst einbringen, angefangen bei ihrem Glauben an das Unternehmen, an die Arbeit, an die Notwendigkeit der Arbeit usw. All diese Dinge klammern die orthodoxen Ökonomen a priori aus ihren abstrakten und verstümmelten Berechnungen aus und überlassen so die Verantwortung für die Produktion und Reproduktion all der verborgenen ökonomischen und sozialen Voraussetzungen für das Funktionieren der Wirtschaft, wie sie sie kennen, stillschweigend den Individuen oder paradoxer Weise dem Staat, dessen Zerstörung sie im übrigen predigen.“