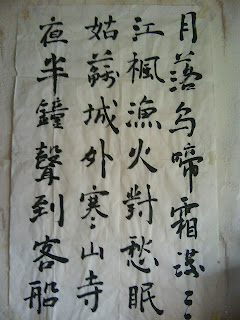Arnold Schönberg hörte in ihr ein erstes Aufblitzen von Atonalität. Adorno erkannte in dem Stück neben all der Polyphonie zwar Einstimmigkeit, aber keine Harmonie, sondern "wie bei Hegel nur Vermittlung durch die Extreme hindurch". Die große Fuge, sie ist mit Sicherheit Beethovens radikalstes Werk.
Montag, 16. Dezember 2013
Mittwoch, 11. Dezember 2013
Lloy Cole: ergrauter Dandy mit Gitarre
Zwei Gitarren, zwei Flaschen Wasser und ein Mikro – mehr braucht Lloyd Cole nicht. Die Präsenz des 52-Jährigen, mittlerweile beachtlich ergrauten Songwriters genügt, um das Publikum am Samstagabend in der Schorndorfer Manufaktur für zweieinhalb Stunden in beinahe andächtige Ruhe zu versetzen.
Ganz alleine, ganz in schwarz gekleidet, steht er da auf der Bühne. Niemand, der ihm die Gitarre bringen würde, kein großes Team im Hintergrund. Nur er und sein Partner Mike, der für den glasklaren Sound in Wohnzimmerlautstärke verantwortlich zeichnet. „Tiny little songs“ habe er mitgebracht. Understatement oder Selbstironie? Cole weiß schließlich nur zu gut, dass seine Songs so viel mehr sind als das.
Die Karriere des Engländers begann im Umkreis des Post-Punk der frühen Achtziger Jahre mit den Commotions und radiotauglichem Indiepop mit leichtem Soul-Einschlag. 1987 verließ Cole die Band, ging nach New York und startete seine Solokarriere. Ein knappes Dutzend Alben hat er seitdem hinterlassen – und dabei so manche musikalische Grenze überschritten. Etwa bei „Selected Works Vol. 1“, einem gemächlich mäandernden Ambientalbum, das er dieses Jahr zusammen mit dem Elektronikpionier Roedelius veröffentlicht hat.
Doch von all dem ist an diesem Abend nichts zu merken. Cole bedient sich zwar allen Phasen seines ganzen musikalischen Schaffens, spielt die Stücke aber so auf den Kern reduziert, dass sich nicht mehr so recht einordnen lässt, in welcher Zeit er sie einst schrieb. Was auch letztlich egal ist. Denn es funktioniert erstaunlich gut. Schnörkellos zupft er die Gitarre, sein Gesang ist makellos, klar und frei von Pathos. Besonders die Songs seines ebenfalls 2013 erschienenen Albums „Standards“, wie die ironische Sozialstudie „Kids today“, profitieren von dieser Reduktion. Cole entfernt alles, was auf seinen Platten bisweilen verproduziert klingt.
Und – so abweisend er auf Fotos auch immer drein blickt – er ist sichtlich gut gelaunt. Cole kokettiert mit seinem Alter, damit dass er manchmal Textzeilen vergisst oder Akkorde falsch spielt. Was dann auch prompt ein paar Mal passiert. Und beinahe beabsichtigt klingt, als er bei „No more love songs“ in der letzten Strophe „no more love songs / still, you might as well...“ singt, dann kurz überlegt, an die Decke schaut, grinst und „...live“ ergänzt. Er sei ja ohnehin nur die Vorband, scherzt Cole. Und verspricht, nach einer kurzen Pause als Hauptact wieder zu kommen.
Das Publikum lauscht all dem seltsam andächtig. Für den Dandy hat der Veranstalter eigens aufgestuhlt, was die kreuzbraven Besucher zusätzlich zu disziplinieren scheint. Kein Laut ist zu vernehmen, während Cole spielt. So etwas kennt man sonst nur vom Klassikpublikum. Beim alten Commotions-Hit „Jennifer she said“ versucht Cole sie dann aus der Reserve zu locken. Beim denkbar einfachen „Ba da ba“-Refrain sollen sie ihn begleiten. Was nur bedingt gelingt, dem Künstler aber immerhin ein anerkennendes „Nicht schlecht, ich dachte für so was seid ihr zu sehr Indierock“ entlockt.
Doch Coles Auftritt selbst fehlt es ein wenig an Dynamik. Er kommt ohne große Höhen und Tiefen aus. Stilistische Variation? Fehlanzeige. Auch Lichteffekte gibt es keine, und so wird Cole den ganzen Abend von einem einzigen hellen Scheinwerfer beleuchtet. Eigenartig sei das auf der Bühne der Manu, stellt er schließlich selbst fest. Er fühle sich da fast wie im Studio. Da wünscht man den Künstler nach dem Konzert dann auch hin. Für eine Platte, ganz akustisch, 45 Minuten. Nur Cole, seine zwei Gitarren und das Mikro. Das könnte funktionieren.
Dienstag, 29. Oktober 2013
Ungewißheit
In dieser hellen Finsternis,
auf welcher wir auf Erden stecken,
wird ein Vernünftiger gar leicht entdecken,
daß alles Wissen ungewiß.
Die Ungewißheit geht sogar so weit,
daß man,
mit Recht und Zuverläßigkeit,
daß alles ungewiß, gewiß kaum sagen kann.
Barthold Heinrich Brockes (1680-1747)
Sonntag, 20. Oktober 2013
Machine Gun
1968 was the perfect time for something radical like Mr. Peter Brötzmann's free jazz manifest Machine Gun:
Dienstag, 3. September 2013
Rottler reduziert
Angekündigt waren "Christian Rottler and friends", doch am Ende stand er an diesem Sommerabend im Merlin alleine auf der Bühne. Von seiner aktuellen Band Lenin Riefenstahl blieb nur das Herzstück: Christian Rottler und seine Melancholie. Zwei seiner Kollegen waren verhindert und sein Schlagzeuger hatte einen schweren Verkehrsunfall. Ein Auftritt unter äußerst widrigen Umständen.
Angedeutete Akkorde, verhuschtes Zupfen, klarer Fokus auf dem Gesang: Rottler präsentierte sich textlastig, musikalisch reduziert, leidenschaftlich rauchend, provokativ selbstbewusst und doch mit den obligatorischen Selbstzweifeln. Rottler spielte maximal reduziert. Eine besondere Schwere lag diesmal über den Songs, mehr Dringlichkeit als ohnehin. Besonders bei "Chlor, Jod und Tenside", seinem ersten neuen Lied seit langer Zeit. Viel von David Foster Wallace und seinem Meisterwerk "Unendlicher Spaß" steckt in diesem Stück. Er spielte es ungewöhnlich langsam, so als ob er das Publikum dazu zwingen wollte, jedes einzelne Wort dieses an Assoziationen reichen Textes aufzusaugen.
Die Reduktion gelang ihm nicht immer zum Vorteil. An mancher Stelle hätte er durchaus weniger Pathos und mehr Rhythmus anbringen können. Gut hingegen die Brüche: Musikvideos, die einen Eindruck davon vermittelten, wie sich seine Traktate in voller musikalischer Besetzung anhören. Sein Text über die gescheitere Proust-Lektüre. "Crash after crash after crash after crash". Und die Videokunst im Hintergrund als Kontrast zum starken und in Schwarzer Krauser-Rauch eingehüllten Bühnen-Ich. Ein wortmächtiger Auftritt.
Montag, 2. September 2013
Ich heiße...
„Wie heißt du?“ „Ich heiße...“ - jeder von uns kennt diese Frage. Und wir alle haben einen Namen. Doch angenommen, wir hätten keinen, würden ihn nicht kennen, ja, könnten überhaupt nicht sicher sein, wer wir überhaupt sind? Der Protagonist von Christian Siglingers Erzählung „Ich heiße...“ jedenfalls trägt keinen Namen.
Seine Eltern, die ihm fremd und unverständlich sind, gaben ihm vielleicht einst einen. Doch es hat ihn noch niemand danach gefragt, bis ihm eines Tages schließlich ein Zwerg begegnet. Genau dieser Umstand führt den Jungen auf eine abenteuerliche Suche nach einem Namen – und sich selbst. Dabei begegnet er sonderbaren Gestalten, redet mit Bäumen, Bächen, Menschen und beschreitet einen Weg von der Natur zur Zivilisation.
Auf jeder Station seiner Reise stellt er immer wieder dieselbe Frage: „Hast du einen Namen für mich?“ Doch keiner hat einen Namen für den Jungen. Und niemand verrät auch den seinen. Denn „ein guter Name ist wie ein gutes Geheimnis“. Der Junge lässt sich durch kein Hindernis aufhalten, so groß ist sein Wunsch, endlich auch einen Namen zu tragen. Denn ohne Namen sind die Menschen sich fremd.
Weil der Junge nicht so recht weiß wer er ist, möchte er unbedingt eine Rolle spielen, völlig gleich welche. Er irrt umher auf der Suche nach etwas, das er darstellen, das ihn darstellen könnte. Und scheitert dabei scheinbar immer wieder aufs Neue. Doch das Nichtwissen, die Umwege und Unsicherheiten erst führen ihn zur Selbstreflexion und zum Erleben. Auf der Suche nach seinem Namen verlässt er das enge familiäre Korsett aus routinierten Abläufen, deren Sinn der Junge ohnehin nie verstand. Er beginnt zu leben und hört auf, gelebt zu werden.
„Ich heiße“ erzählt zwar eine Kindergeschichte, doch begnügt sich nicht damit. Die schroffen Illustrationen von Daniel Bubeck zeigen dabei eine menschen- und trostlose Welt, in der sich die Reise abspielt. So entsteht – bewusst oder unbewusst - ein Kontrapunkt zur bildhaften Sprache der Erzählung. Die düsteren und kargen Konturen, in denen die Geschichte dargestellt wird, verstärken die textimmanente Technik- und Zivilisationskritik. Ob der Junge wohl am Ende (s)einen Namen finden wird?
Mittwoch, 21. August 2013
Donnerstag, 1. August 2013
Das sind doch Menschen
Das sind doch Menschen, denkt man,
wenn der Kellner an einen Tisch tritt,
einen unsichtbaren,
Stammtisch oder dergleichen in der Ecke,
das sind doch Zartfühlende, Genüßlinge
sicher auch mit Empfindungen und Leid.
So allein bist du nicht
in deinem Wirrwarr, Unruhe, Zittern,
auch da wird Zweifel sein, Zaudern, Unsicherheit,
wenn auch in Geschäftsabschlüssen,
das Allgemein-Menschliche,
zwar in Wirtschaftsformen,
auch dort!
Unendlich ist der Gram der Herzen
und allgemein,
aber ob sie je geliebt haben
(außerhalb des Bettes)
brennend, verzehrt, wüstendurstig
nach einem Gaumenpfirsichsaft
aus fernem Mund,
untergehend, ertrinkend
in Unvereinbarkeit der Seelen -
das weiß man nicht, kann auch
den Kellner nicht fragen,
der an der Registrierkasse
das neue Helle eindrückt,
den des Bons begierig,
um einen Durst zu löschen anderer Art,
doch auch von tiefer.
(Gottfried Benn)
wenn der Kellner an einen Tisch tritt,
einen unsichtbaren,
Stammtisch oder dergleichen in der Ecke,
das sind doch Zartfühlende, Genüßlinge
sicher auch mit Empfindungen und Leid.
So allein bist du nicht
in deinem Wirrwarr, Unruhe, Zittern,
auch da wird Zweifel sein, Zaudern, Unsicherheit,
wenn auch in Geschäftsabschlüssen,
das Allgemein-Menschliche,
zwar in Wirtschaftsformen,
auch dort!
Unendlich ist der Gram der Herzen
und allgemein,
aber ob sie je geliebt haben
(außerhalb des Bettes)
brennend, verzehrt, wüstendurstig
nach einem Gaumenpfirsichsaft
aus fernem Mund,
untergehend, ertrinkend
in Unvereinbarkeit der Seelen -
das weiß man nicht, kann auch
den Kellner nicht fragen,
der an der Registrierkasse
das neue Helle eindrückt,
um einen Durst zu löschen anderer Art,
doch auch von tiefer.
(Gottfried Benn)
Mittwoch, 24. Juli 2013
Freitag, 19. Juli 2013
Wettbewerbsfähig oder sozial gerecht?
Am 22. September ist Bundestagswahl. Doch noch ist wenig zu spüren vom Walhkampf. Unlängst hatten die Kandidaten des Wahlkreis Waiblingen auf Einladung des Wirtschaftsforums Welzheimer Wald/Wieslauftal nun eine erste Möglichkeit ihre Positionen – die um den Konflikt zwischen Wettbewerbsfähigkeit und sozialer Gerechtigkeit kreisten – gegeneinander abzugrenzen.
Bereits bei der Zustandsbeschreibung herrschte unter den Kandidaten Uneinigkeit: Geht es Deutschland nun gut? Oder droht sich unsere Gesellschaft in Arm und Reich zu spalten? Ist die Energiewende Wachstumsmotor oder eine Gefahr für unsere Wettbewerbsfähigkeit? Dissenz erst recht bei den Zielen: Sind die rot-grünen Steuerpläne nun eine Form sinnvoller Umverteilung oder der direkte Weg in Rezession und Enteignung?
Umstrittene rot-grüne Steuerpläne
Für Dr. Joachim Pfeiffer (CDU) und Hartfrid Wolff (FDP) waren es auf jeden Fall vier gute Jahre. Diesen Weg gelte es nun fortzusetzen. „Das Entscheidende dafür ist die Wettbewerbsfähigkeit“, betont Wolff. Die stellt auch Pfeiffer in den Mittelpunkt und warnt zugleich: „Es wäre fatal, wenn die Steuerpläne von Rot-Grün umgesetzt werden“. Beide Parteien fordern unter anderem einen höheren Spitzensteuersatz, die SPD zudem eine Vermögenssteuer, die Grünen eine Vermögensabgabe. Für Wolff ein ganz klarer Fall von „falscher Enteignung“. Die deutsche Wirtschaft könne das nur schwerlich verkraften. Eine junge Dame aus dem Publikum äußert gar echte Zukunftsangst im Falle eines möglichen rot-grünen Wahlsiegs.
SPD-Kandidat Alexander Bauer sieht die Zukunft hingegen optimistischer. Denn der geplante Spitzensteuersatz von 49 Prozent treffe ohnehin nicht die Mittelschicht. Auch Grünen-Kandidatin Andrea Sieber betont: „Ein Großteil der Bevölkerung wird durch unsere Pläne entlastet“. Und fügt hinzu: „Ein Teil bekommt die Chance, sich zu beteiligen“ - eine Bemerkung, die im Publikum lautes Gelächter hervorruft. Die zentrale Frage sei eben die nach sozialer Gerechtigkeit. Alexander Bauer: „Ohne sozialen Frieden ist alles andere nichts. Er ist das Rückgrat unserer Demokratie“.
Agenda 2010 – Kahlschlag oder Impuls für die Wirtschaft?
Beide fordern daher auch Korrekturen an der Agenda 2010, die Rot-Grün unter Schröder damals selbst eingeführt hatte. Bauer nennt sie „das wunde Herz der SPD“. Es gelte nun, die Stellschrauben neu zu stellen. Auch Sieber meint: „Die Absicht der Gesetze war gut, doch es gibt es ganz großen Nachbesserungsbedarf“. Unsere gute Wirtschaftslage, darauf legt sie wert, sei allerdings ohne diese Gesetze nicht möglich gewesen. FDP-Mann Wolff kann da nur den Kopf schütteln: „Und daher wollen sie die jetzt wieder abschaffen?“ Für Udo Rauhut, den Kandidaten der Linkspartei gibt es da gar nichts herum zu diskutieren, sein Urteil ist eindeutig: „Das war der größte soziale Kahlschlag in der Geschichte der Bundesrepublik“. Pfeiffer hingegen spricht bei den Gesetzen, die im Bundesrat von allen Parteien außer der damaligen PDS beschlossen wurden, von einer „Gemeinschaftsleistung aller“. Wer diese zurückdrehen wolle, riskiere dass Deutschland wieder zum „kranken Mann Europas“ werde. Was wir vielmehr bräuchten sei eine Agenda 2030.
Und die Energiewende? Für Wolff und Pfeiffer aufgrund der Energiepreisentwicklung eine Frage der Wettbewerbsfähigkeit. Wolff plädiert klassisch liberal: „Wir müssen zusehen, dass die Bürokratie- und Steuerlast nicht zu hoch wird“. Und Pfeiffer spricht von „Gefahr in Verzug“, denn „Energiekosten sind die momentan entscheidendste Frage für die Wirtschaft“. Bauer hingegen mag diese Angstmacherei nicht verstehen. Er sieht die Energiewende vielmehr als langfristige Investition und appelliert an die Unternehmen: „Bitte nicht zu kurzfristig denken!“ Doch gelingen könne sie, da ist er sich mit der Grünen- und dem Linken-Kandidaten einig, nur dezentral.
Ein Thema, bei dem sich die Kandidaten zumindest in der Problemdefinition einig sind ist die Infrastruktursituation im Kreis. Viele Straßen, so der einhellige Tenor, seien in einem katastrophalen Zustand. Die Instandhaltung der bestehenden Infrastruktur schreiben sich alle Kandidaten auf die Fahne. Bei der Frage, ob zusätzliche Straßen gebaut werden sollen, gehen die Meinungen allerdings wieder auseinander. Rauhut meint dazu: „Warum sollen die Bürger das nicht selbst entscheiden? In der Schweiz funktioniert das ja auch“. Wolff und Pfeiffer würden lieber heute als morgen mit dem Ausbau etwa von B14 und B29. Auch Bauer spricht sich für einen Ausbau der B29 Richtung Aalen aus. Nur Andrea Sieber von den Grünen möchte „weiter denken, anders denken“. Mobilität ist für sie mehr als nur Automobilität. Sie fordert einen Mobilitätsplan, der Konzepte für die Carsharing, Fahrradwege und einen verbesserten öffentlichen Nahverkehr beinhaltet. Dies betreffe letztlich auch Fragen der Inklusion, denn „es ist momentan gar nicht für alle möglich, an Mobilität teilzunehmen. Und das sind Sachen, die mich tatsächlich bewegen. “
Montag, 15. Juli 2013
Das Geschäft mit deutschen Waffen
Der Waffenhandel in Deutschland ist für Jürgen Grässlin ein Lebensthema. Seit mehr als dreißíg Jahren ist er als Friedensaktivist aktiv, seit 1999 Sprecher der Deutschen Friedensgesellschaft. Die Rüstungsindustrie kennt er wie kein zweiter. Zahlreiche Bücher hat er über sie verfasst. Seine Hauptgegner: Heckler & Koch und Daimler/EADS. Und er besucht regelmäßig Opfer deutscher Waffen in Kriegsgebieten. Jetzt hat er in einem 624 Seiten dicken Wälzer namens „Schwarzbuch Waffenhandel“ sein gesammeltes Wissen komprimiert.
Und darin steht eine ganze Menge darüber, wie der Waffenhandel in Deutschland funktioniert, wer zu den Verantwortlichen zählt und wie es überhaupt dazu kommen konnte, dass heute etwa jedes zweite Gewehr der Welt eine G3 von Heckler & Koch ist, übertroffen nur noch von der Kalaschnikow. „Handfeuerwaffen wohlgemerkt sind die tödlichste aller Waffen überhaupt“, sagt Grässlin - und gerade bei diesen sei der Export in den letzten Jahren geradezu explodiert. Eine deutsche Spezialität: das Hochrüsten verfeindeter Bevölkerungsgruppen und Staaten.
„Beim Waffenhandel gibt es keine Demokratie“
Dafür macht Grässlin zunächst die Politik verantwortlich, denn „beim Waffenhandel gibt es keine Demokratie“. Über Exporte bestimmt der Bundessicherheitsrat, ein geheim tagendes Gremium, bestehend aus Kanzlerin, Vizekanzler, sowie sieben Ministern. Was dieser beschließt bleibt für die Öffentlichkeit, selbst für das Parlament im Verborgenen. Kein anderer Kanzler habe mehr Exporte zu verantworten als Helmut Kohl. Doch Angela Merkel sei auf dem besten Wege, ihn zu übertreffen. 2010 erreichte sie mit einer Exportsumme von knapp 2,2 Mrd. Euro den bisherigen Höchstwert. Die Masse an „Dual-Use“, also der zivil wie militärisch nutzbaren Güter nicht mitgerechnet.
Doch heikle Rüstungsexporte sind beileibe keine Spezialgebiet der Bürgerlichen. Auch Rot-Grün ist sich unter Schröder nicht zu schade dafür gewesen und unterstützte ab 2004 den libyschen Diktator Gaddafi. Merkels neuster Großinvestor ist nun seit kurzem Saudi-Arabien. Für den Häuserkampf zugeschnittene Leopardpanzer hat die Bundesrepublik im Angebot. „Die lassen sich prima dazu einsetzen, in Demonstrantenmassen reinzufahren.“ Das sei Teil ihrer Doktrin: „Mehr Rüstungsexporte, weniger Soldaten“. Eine sich christlich nennende Partei unterstütze also ausgerechnet ein Land mit Waffen, in dem es unter Strafe verboten ist, eine Bibel mit sich zu tragen. Sogar eine Linzenz zur Produktion von G36-Sturmgewehren habe das Land erhalten. Ganz vorne mit dabei, wenn es um Rüstungslobbyismus geht: CDU-Fraktionschef Volker Kauder. In seinem Wahlkreis beheimatet: Heckler & Koch. Zwei Millionen Todesopfer habe dieses Unternehmen laut Grässlin seit seinem Bestehen zu verantworten, „die Heckler & Koch-Uhr, sie tickt“.
Illegale Exporte von Heckler & Koch
Immer wieder sei das Unternehmen aus Oberndorf aufgefallen durch seine illegalen Waffenexporte. 2010 hat Grässlin den Konzern deshalb angezeigt. Seine Begründung: das Rüstungsunternehmen habe illegal Waffen in Unruheprovinzen Mexicos geliefert. Ein Vorwurf, der inzwischen von mehreren ehemaligen Mitarbeitern bestätigt wurde. Noch hat das Landgericht nicht entschieden, ob es ein Strafverfahren einleitet. Grässlin: „Der Kampf gegen die Rüstungsindustrie ist auch manchmal ein Kampf gegen die Justiz.“
Doch der Friedensaktivist ist zuversichtlich. Zwei Unterlassungsklagen von Daimler aus dem Jahre 2005 hat er bereits überstanden. Bis zum Bundesgerichtshof ging die Sache, wo die Klage schließlich abgelehnt wurde. Denn Grässlin war Daimler ein Riesendorn im Auge. Als einer der Kritischen Aktionäre bei Daimler (Grässlin besitzt genau eine Aktie) war er über Jahre bei jeder Jahreshauptversammlung anwesend um sein Rederecht zu nutzen. Da sprach er dann etwa über die 150 000 Militärunimogs, die der Autohersteller in über 80 Länder (darunter Syrien und Irak) geliefert hat. Oder die Geschäfte der EADS, Europas zweitgrößtem Rüstungskonzern. Erst vor wenigen Wochen hat Daimler seine Anteile daran verkauft. Ein kleiner Erfolg für den Friedensaktivisten, immerhin.
Grässlin möchte aber, dass sich etwas ganz grundsätzlich ändert in Deutschland. 78 Prozent der Deutschen seien für ein völliges Verbot des Waffenhandels. Genau dies fordert nun die Initiative „Aufschrei Waffenhandel“, um deren ausdrückliche Unterstützung er bittet. Die bekommt er vom SPD-Bundestagskandidaten zwar nicht schriftlich. Dennoch zeigt sich Bauer in der anschließenden Diskussion sichtlich nachdenklich. Und verspricht zumindest, sich der Sache anzunehmen, sofern er es denn in den Bundestag schafft.
Die drei „Lebenslügen“ der Rüstungsindustrie (nach Grässlin):
- Die Rüstungsindustrie sichert wichtige Arbeitsplätze – Grässlin: Arbeitsplätze der Vergangenheit vielleicht. Allein die Energiewende hat schon ein zigfaches mehr an Arbeitsplätzen geschaffen als die Rüstungsindustrie, das ist die Zukunft.
- Wenn wir nicht liefern liefern die anderen – Grässlin: Falsch. In der Realität ist es so: Wenn die andern nicht liefern, liefern wir.
- Regt euch nicht auf, eine Waffe ist neutral – Grässlin: Eine Waffe ist nie neutral, denn ihr Ziel ist es, zu töten.
Mittwoch, 26. Juni 2013
Wo das Geld der "Griechenland-Rettung" wirklich landet
Kaum ein Volk wurde in den letzten Jahren so sehr gescholten wie die Griechen. Doch die angebliche Rettungspolitik von EU und IWF diente hauptsächlich dem Finanzsektor. Dazu gibt es nun endlich Zahlen. Einer neuen Attac-Studie zufolge sind ca. 160 von 207 Milliarden Euro direkt bei Banken und Kapitalanlegern gelandet, darunter nicht wenige aus Deutschland. Und von den ca. 47 Milliarden, die im griechischen Staatshaushalt angekommen sind, flossen knapp 35 Milliarden als Zinsen gleich weiter an die Besitzer griechischer Staatsanleihen. Nur so als Argumentationshilfe, wenn sich demnächst mal wieder jemand darüber beschwert wie viel Geld wir doch den "faulen Griechen" in den Rachen geworfen haben.
Das deutsche Medien-Oligopol
Die hiesigen Zeitungsverlage haben für die Herausforderung der Digitalisierung noch keine wirkliche Lösung gefunden. Anzeigeneinnahmen gehen drastisch zurück und immer weniger Menschen sind bereit, Geld für Informationen auszugeben, die sie auch online kostenlos bekommen. Dennoch: nur in wenigen Ländern gibt es eine solch vielfältige, qualitativ hochwertige Presselandschaft. Noch, denn die deutsche Mainstream-Medienlandschaft täuscht mittlerweile eine Vielfalt vor, die so nicht mehr existiert. Zehn Medienhäuser, die vor allem auf Profit aus sind, bilden ein Oligopol, sie dominieren den Markt. Ihr Geld und ihr Einfluss bestimmen, was gedruckt oder gesendet wird. Unabhängiger Journalismus wird zunehmend erschwert. In vielen Regionen haben sie keine Konkurrenz mehr. Und der Konzentrationsprozess verstärkt sich, auch intern - auf Kosten der Qualität. Arbeitsplätze werden abgebaut, Redaktionen zusammengelegt, Newsdesks als Fortschritt verkauft, die eigentlich nur der Kosteneinsparung dienen. Die Bedingungen für die schreibende Zunft, sie sind zunehmend prekär. Wie da in Zukunft noch unabhängiger Qualitätsjournalismus möglich sein soll, bleibt fraglich. Einige dieser Aspekte beleuchtet ein kürzlich erschienener Essay über die "Krakenarme der Medienmultis" in der Wochenzeitung Kontext.
Donnerstag, 6. Juni 2013
Dienstag, 4. Juni 2013
Wie Ernst Heinkel von den Nazis profitierte
Eine Schule haben sie in Grunbach nach ihm benannt und sein Name ziert unzählige Straßen. Doch wie sehr sich Ernst Heinkel in der NS-Zeit schwerer Verbrechen schuldig gemacht hat, wurde bisher kaum beachtet. Das Bild von Ernst Heinkel muss nach neustem Stand der Forschung korrigiert werden.
Denn bisher ist Ernst Heinkel vor allem als Technikpionier bekannt. Als jemand, der einen Zeppelinabsturz mit eigenen Augen erlebte und beschloss, fortan selbst bessere Flugzeuge zu konstruieren. Und der am 27. August 1939, kurz vor Kriegsbeginn, eine He 178 auf dem Flughafen Rostock-Marienehe zum Starten bringt. Der Jungfernflug des ersten Düsenflugzeugs der Welt gilt als Meilenstein der Luftfahrtgeschichte.
Doch Technik ist nie völlig neutral. Und ganz besonders war sie das nicht während der Zeit der NS-Herrschaft, schon gar nicht im Fall von Ernst Heinkel, denn „kaum ein Industrieller war im Dritten Reich mehr mit dem Regime verstrickt als Heinkel“, sagt Historiker Dr. Lutz Budraß, ein Experte auf dem Gebiet der deutschen Luftfahrt.
Unlängst habe ich zu dem Komplex "Ernst Heinkel und der Nationalsozialismus" einen Text veröffentlicht. Hier der Link.
Eine Sammlung der Artikel zur Heinkel-Debatte in seinem Geburtsort Grunbach findet sich auf der Homepage des Museumsvereins Remshalden.
Eine Sammlung der Artikel zur Heinkel-Debatte in seinem Geburtsort Grunbach findet sich auf der Homepage des Museumsvereins Remshalden.
Freitag, 31. Mai 2013
Die Kolonie des Südens
Brasilien, das sind eigentlich zwei Länder: auf der einen Seite der entwickelte Süden, auf der anderen der ländliche, rückständige Norden. Zwischen diesen beiden tobt ein Kampf um Boden, Rohstoffe und Energie. Poema e. V. unterstützt seit zwanzig Jahren die Menschen im Norden, genauer im Amazonasgebiet.
Denn dort, in Amazonien, ist die Not groß und die Bevölkerung schwach im Kampf gegen die Mächtigen. In den Bundesstaaten Para und Amapa sind sie mit ihrem Verein aktiv. Im April waren der Waiblinger Bernhard Hindersin und der Stuttgarter Gerd Rathgeb, Vorsitzender von Poema, unterwegs, um sich über die Lage vor Ort zu informieren. Ihre Partner sind Gemeindeverwaltungen, Kooperativen oder Selbstverwaltungen der Indios.
„Amazonien, das ist eigentlich nicht Brasilien“, so Rathgeb. „Niemand geht dort hin, außer wenn er etwas holen möchte.“ Rund 215 Völker haben dort ihr traditionelles Siedlungsgebiet. „Und ihr Image ist in Brasilien nicht gut. Der Norden wird von vielen Brasilianern einfach als Rohstoffabbaugebiet betrachtet“, wie Rathgeb konstatiert. Er sei so etwas wie die Kolonie des Südens.
Großgrundbesitzer haben in den vergangenen Jahrzehnten nach und nach den Regenwald in Besitz genommen. Zunächst wurde Holz abtransportiert. Oft mit illegalen Methoden. Die Besitzverhältnisse in diesem Gebiet sind nicht klar geregelt. Auf den frei gewordenen Flächen haben sich die Großgrundbesitzer mittlerweile aber auch der Rinderzucht und dem Sojaanbau gewidmet. Ein Riesengeschäft: Auf 190 Millionen Einwohner kommen in Brasilien mittlerweile 210 Millionen Rinder, davon allein 15 Millionen in der Amazonasregion. 50 Prozent davon werden exportiert. Für Natur und Mensch aber eine fatale Entwicklung, denn die Regenwaldböden sind sehr nährstoffarm und schon nach kurzer Zeit degradiert. Hinzu kommt der massive Einsatz von Pestiziden. Schon nach wenigen Jahren sind die Böden unbrauchbar und das Mikroklima verändert sich.
„Im Grunde sind das rechtsfreie Gebiete“
20 bis 25 Prozent des brasilianischen Regenwaldes sind auf diese Weise bereits verloren gegangen. Wer sich dagegen wehrt oder gar versucht, verlorenes Land durch Besetzungen zurückzugewinnen, muss um sein Leben fürchten, denn „im Grunde sind das rechtsfreie Gebiete“, so Gerd Rathgeb. Und die Konzerne schrecken nicht davor zurück, Auftragskiller einzusetzen. Die katholische Ordensschwester Dorothy Stang, eine Partnerin des Vereins Poema, musste 2005 mit 71 Jahren ihr Leben lassen, weil sie gegen die unrechtmäßige Besetzung von Land Protest organisierte.
Aber auch für die Energieversorgung müssen mittlerweile Flächen weichen. Für Belo Monte etwa, das drittgrößte Staudammprojekt der Welt (der anderthalbmal so groß wie der Bodensee wird) mitten im Amazonasgebiet am Xingu. Der soll für das Projekt umgeleitet werden, denn das Gefälle ist für ein Wasserkraftwerk einfach zu schwach.
Die Regierung zwingt die Xingu-Indios, die den Fluss als heilig betrachten, zur Umsiedlung, oft ohne entsprechende Entschädigung. Sie werden ihrer Lebensgrundlage, dem Fischfang, beraubt. Rechtlich ist auch hier vieles fragwürdig. Der Eingriff in die Umwelt ist massiv. Ein Projekt dieser Größe hält Bernhard Hindersin daher für fragwürdig. „Und es ist eigentlich beschämend, dass so ein sonnenreiches Land wie Brasilien nicht auf Solarenergie setzt.“ Seit Jahren gibt es Proteste und Prozesse gegen das Projekt. Auch nach Deutschland hat der Verein ihn getragen. Denn, so Hindersin, „hier wird der Zusammenhang zwischen uns und dem was in Amazonien abläuft, besonders deutlich. Die Turbinen kommen von Voith Turbo, die 500 Lastwagen auf der Baustelle von Daimler, Stihl mit seinen Kettensägen ohnehin.“
Auch Siemens und die Münchner Rück sind an dem Projekt beteiligt. Voith in Heidenheim, wo die beiden im Juni vergangenen Jahres demonstrierten, rechtfertigte sich damit, dass Brasilien ja ein Rechtsstaat sei. „Brasilien“, so Rathgeb, „ist zwar ein Rechtsstaat, aber er setzt einseitig auf Rohstoffe und Lebensmittel.“ Besonders für die Indios ergibt sich ein Land- und Ernährungsproblem. Und „durch die Austrocknung des Flusses wird Methan freigesetzt. Dieser Staudamm ist alles andere als CO2-neutral.“ Vieles liegt im Argen am Amazonas.
Bei der Reise im April haben die beiden daher bestehende Projekte überprüft und gefragt: Wo drückt der Schuh? Viel Aufklärung ist noch nötig: „Die Klimaproblematik, global wie lokal, ist vielen fremd“, so Rathgeb. In den dünn besiedelten Gebieten sind vor allem sauberes Trinkwasser, Energie und Gesundheitsversorgung ein Problem. Am Rio Tocantins etwa stellt der Verein mit Solarstrom betriebene UV-Lampen zur Verfügung, die das sehr eisenhaltige Flusswasser reinigen. Gelder fließen auch in den Brunnenbau und die Finanzierung von Gesundheitsstationen. Und mit Solarzellen und -lampen soll den zumeist von der Stromversorgung abgekoppelten Menschen Licht, aber auch der Zugang zur Bildung ermöglicht werden, denn um kurz nach sechs ist es schon dunkel im Amazonas.
Es geht um Hilfe zur Selbsthilfe. Früher arbeitete Poema nach dem Prinzip „Wir liefern, ihr arbeitet“. Inzwischen ist finanzielle Selbstbeteiligung ein wichtiges Thema. „Das ist natürlich symbolisch“, so Rathgeb, „denn das an uns gezahlte Geld fließt in einen Fonds, der wiederum den jeweiligen Gemeinden zugutekommt“. Auf diese Weise soll deren Autonomie gestärkt werden.
Einen Schwerpunkt setzt der Verein aber auch auf die Information der Menschen hierzulande. „Wir wollen den Zusammenhang deutlich machen zwischen unserem Konsum und Lebenswandel und der Situation im Amazonas“, so Hindersin. Denn letztlich fällt das auch auf uns zurück. Etwa die Hälfte der Tier- und Pflanzenwelt der Erde befindet sich schließlich dort. Ein Kulturschatz der Menschheit wird zerstört. Einer auch der das Klima – noch – im Gleichgewicht hält.
Ein Dekadenprojekt
Poema steht für Pobreza Emeio ambiente na Amazônia, das heißt Armut und Umwelt in Amazonien. Für seine Projekte wurde Poema 2008 als offizielles Dekadenprojekt der Vereinten Nationen ausgezeichnet. Der Verein finanziert sich aus schließlich aus Spenden. Kontonr. 702 466 7101 bei der GLS-Bank Nr. 430 609 67. Mehr Infos unter www.poema-deutschland.de
Donnerstag, 2. Mai 2013
Rechtsterrorismus in Europa
Auf den Tag genau vor 80 Jahren sind von SA und SS die deutschen Gewerkschaften zerschlagen worden. Ein großer Teil der Arbeiterbewegung landete hinter Gittern. Die freie Gewerkschaftsbewegung hörte fortan auf zu existieren und die nationalsozialistische NSBO übernahm das Kommando. Am gestrigen Tag der Arbeit haben Gewerkschafter im ganzen Land an diese NS-Untat erinnert, die doch nur den Auftakt bildete für viel größere Verbrechen und zur Verfolgung und systematischen Vernichtung alles Unvölkischen.
Auch heute, 80 Jahre später, findet das Gedankengut dieser Zeit immer noch Anklang. Am 6. Mai beginnt nun der Prozess gegen den NSU vor dem OLG in München. Noch ist vieles unklar in Bezug auf diese Terrorzelle, die sich als solche bis zu ihrem Untergang nie zu erkennen gab, gerade was die Rolle der Geheimdienste anbelangt. Doch die verbreitete Geschichtsvergessenheit in der Berichterstattung erstaunt. Wir haben es hier keineswegs mit einem völlig neuen Phänomen zu tun. Denn nicht nur Deutschland, nahezu ganz Europa blickt auf eine lange Geschichte des braunen Terrors zurück. Der Rechtsterrorismus ist eben keine Folge der deutschen Wiedervereinigung, auch wenn diese der Bewegung einen deutlichen Schub gab. Seine Wurzeln reichen in der Bundesrepublik bis weit in die Fünfziger Jahre zurück. Eine sehenswerte Arte-Dokumentation von 2012 fasst die Entwicklungen in Deutschland und ganz Nachkriegseuropa gut zusammen. Sie zeigt die Verstrickungen mit staatlichen Institutionen (auch wenn sie die Rolle der Stay Behind/Gladio-Geheimarmeen leider gänzlich ausblendet), verdeutlicht die kontinuierliche Unterschätzung der Bewegung und berichtet von der ungebrochenen Attraktivität des nationalsozialistischen Gedankenguts in ganz Europa.
Mittwoch, 1. Mai 2013
Schöne neue Arbeitswelt
Befristet, geringfügig beschäftigt, geliehen – prekäre Arbeit hat viele Gesichter. Doch eines haben sie alle gemein: sie nehmen der Arbeit und dem Arbeiter die Würde. So die zentrale These des Industrieseelsorgers Paul Schobel, der am Dienstagabend auf Einladung des DGB in der Manufaktur über die Apartheit in der Arbeitswelt referierte.
Apartheit ist ein starkes Wort, doch für den Katholiken Paul Schobel, der auf 40 Jahre Erfahrung in der Betriebsseelsorge zurückblicken kann, beschreibt es ziemlich genau die Entwicklung der letzten Jahre, in denen sich die Arbeitswelt zunehmen aufspaltete in tarifgebundene sichere Arbeitsplätze und sogenannte „bad jobs“. Arbeit dürfe nicht beliebig sein, kein reiner Kostenfaktor. Doch genau das sei sie momentan: „Sie wird ausgepresst wie eine Zitrone, nur um sie danach wegzuschmeißen.“ Das könne ihn als katholischen Pfarrer nicht kalt lassen, denn „man kann nicht sagen, ich würde hier den Teufel beschwören. Er ist schon da.“ In Form der schönen neuen Arbeitswelt. Huxley lässt grüßen.
Um die Würde der Arbeit zu erklären, greift er auf dabei das Gleichnis der drei Steinmetze zurück, die gemeinsam auf einer Baustelle arbeiten. Als ein Passant sie danach fragt, was sie denn tun, antwortet der erste barsch: „Siehst du das nicht? Ich verdiene meinen Lebensunterhalt!“ Der zweite klopft mit wichtiger Miene auf seinen Stein: „Ich mache die besten Steinmetzarbeiten weit und breit.“ Der dritte jedoch schaut den Passanten mit glänzenden Augen an und sagt: „Ich arbeite mit am großen Dom.“
Dieses Glänzen, dieser Sinn für das große Ganze ist es, das Paul Schobel als Wert der Arbeit zumisst. Doch die Realität sehe leider völlig anders aus. So sei es etwa bei der Leiharbeit üblich, diese in den Betrieben als Sachkosten aufzulisten, „verächtlicher kann man mit Arbeit wohl nicht umgehen. Arbeitsbeziehungen werden so zu logistischer Materialbeschaffung degradiert.“ Dass Leiharbeiter schlechter bezahlt werden und über keine arbeitsrechtliche Absicherung verfügen, erscheine da nur logisch. Im Endeffekt führe dies zu gespaltenen Belegschaften. Die Leiharbeit, so seine Forderung, müsse raus aus der „Gitterbox der Materialverwaltung“. Die Gewerkschaften hätten dabei die Aufgabe, sich schützend vor die Leiharbeiter zu stellen, auch ohne gesetzlichen Auftrag. Denn die Spaltung der Belegschaft sei gewollt. Diese Apartheid gelte es zu unterlaufen.
Schließlich würde Leiharbeit als gezielter Spaltpilz in der Belegschaft eingesetzt. „Teile und herrsche war immer die Strategie von denen da oben.“ Arbeitgeberrisiko werde so auf die Arbeitnehmer abgewälzt. „Der Schwache trägt den Rucksack der Starken – als ob er nicht ohnehin schon genug zu tragen hätte.“ Immer wieder kommt an diesem Abend auch die Agenda 2010 zur Sprache. Hier habe diese unselige Entwicklung, so Schobel, ihren Anfang genommen.
Und Baden-Württemberg stehe dabei deutschlandweit an der Spitze. Nirgendwo gebe es etwa mehr geringfügige Beschäftigung. Vor allem Frauen seien davon betroffen. „Das ist nicht nur ein Unrecht und eine Beleidigung dieser Menschen, sondern auch eine ökonomische Dummheit sondergleichen“. Denn von dieser Arbeit könne man weder heute gut leben, noch sorge sie für eine Absicherung im Rentenalter.
Dass die Arbeit so „verludern“ konnte, komme nicht von ungefähr. Alles stehe mittlerweile unter der Knute der Rentabilität, folge dem Wahn der Verwertbarkeit. Schobel findet dafür den Begriff des „primitiven Kapitalismus“ bei dem die Arbeit auf einen schäbigen Wühltisch mit preiswerten Schnäppchen für die Wirtschaft komme. Doch „gute Arbeit ist niemals Feinschmeckerei, es geht um das lebensnotwendige Schwarzbrot.“
Um die Arbeit aus der „Schmuddelzone“ herauszuholen seien neben Politik und DGB aber auch die Konsumenten gefragt. Eine Kauf-Mentalität des „Geiz ist geil“ führe letztlich nur zum sozialen Freitod. Denn die versteckte Botschaft laute: Billig ist gut. Der Preis dürfe aber nicht das einzige Kriterium für die Kaufentscheidung sein. „Aus jeder Kaufentscheidung muss eine ethische Entscheidung werden“ - zumindest für jene mit den gefüllten Geldbeuteln. Dabei gelte es das Soziale und Ökologische nicht auseinander zu dividieren: „Wir brauchen einen universellen Nachhaltigkeitsbegriff“. Was wir gerade erleben, habe Marx recht gut analysiert, so der Theologe. Schobel selbst beschreibt unser System als „Rossbolla-Kapitalismus“: wenn man die Pferde füttere, falle auch noch was für die Spatzen ab. Reichtumsvermehrung statt Armutsverhinderung, so laute das Programm.
Doch „das Kapital muss raus aus dem Führerhaus und ab in die Dienstleistungsklasse“. Die Marktwirtschaft müsse sozial, ökologisch und demokratisch umgestaltet werden – „und zwar auf allen Ebenen“. Wie ein solches System aussehen könnte, beschreibt Christian Felber in seinem Buch „Gemeinwohlökonomie“, das Paul Schobel allen Zuhörern empfiehlt. Die zentrale These: unser System setze die falschen Anreize. Daher müsse der Staat ein neues Anreizsystem erschaffen, in dem jene Betriebe belohnt werden, die nach sozialen, ökologischen und demokratischen Standards wirtschaften. Nur so könne man das Glänzen in den Augen der Arbeiter wieder zurückholen, das Gefühl: „auch ich arbeite mit am großen Dom“.
Der Betriebsseelsorger
Paul Schobel, Grenzgänger zwischen Arbeitswelt und Kirche, wurde 1963 zum Priester geweiht und fand bald darauf seine Berufung in der Betriebsseelsorge im Raum Böblingen/Sindelfingen, wo er sich seit gut 40 Jahren um die Zu-kurz-gekommenenen, Gemobbten und Ausgebeuteten kümmert. Er stand auch schon mehrmals bei Daimler am Band und ist regelmäßig auf SWR1 und SWR4 zu hören, wo er aus theologischer Perspektive über so unterschiedliche Themen wie Drohnen, Altersarmut oder Gartenzwerge sinniert.
Freitag, 19. April 2013
Augenrändercharme
Kaum ein Album habe ich im vergangenen Jahr öfter gehört als Augenrändercharme. Und dennoch fällt es mir immer noch schwer, darüber zu schreiben. Vielleicht, weil ich den Musiker kenne. Daher wird diese Besprechung zwangsweise etwas persönlich. Vielleicht aber auch, weil dieses Werk für mich nur schwer zu fassen ist.
Das liegt mit Sicherheit an der Sprache von Christian Rottler, der auch schon mit mehreren Hörspielen glänzte. Nichts ist da klar, alles steckt voller Zitate, Anspielungen. Er stellt schier endlose Bezüge her - vor allem zu Literatur und Philosophie. Der Künstler ist ein sehr belesener Mensch. An manchen Stellen scheint er sich hinter diesen Bezügen verstecken zu wollen. Dann aber bringt er so ein Stück wie "Perfektion". Das ist keiner der Songs, die bei mir gleich angeschlagen haben. Überhaupt nicht. Aber irgendwann traf es mich. Da versucht einer, sich zu winden, ein Versprechen auf ein Morgen abzugeben, das wohl nie kommen wird. Verspricht "schlichte Perfektion".
Oder nehmen wir "Feuer", das es als Single anno 2006 in die Heavy Rotation von Motor-FM geschafft hat. Bilder steigen auf, aber am Ende bleibt vieles, wie so oft, unklar. Denn Christian Rottlers Texte sind meist eher assoziativ, denn erzählend. Sein musikalischer Stil hingegen ist spielerisch, regelrecht leicht, eigenwillig. Er lässt sich ebenso wenig in eine Schublade einordnen wie die Texte. Es sei denn, es würde Augenrändercharme draufstehen.
Apropos Schubladen: Das erstaunlichste an dieser Platte ist, dass sie seit mittlerweile sieben Jahren in eben einer solchen liegt. Auf den Beachtungs-Erfolg der "Feuer"-EP, sowie die Split-EP "Das funktionierende Leben", die er mit Somos zusammen veröffentlichte, folgte einfach nichts. Wir haben es hier also mit einem Werk zu tun, das eine für den Künstler längst abgeschlossene Lebensphase abbildet. Vieles würde er heute wohl ein wenig anders machen. Die atemlose Dringlichkeit der Stücke etwa. Oder den Text von "Free Solo - Freihand". Das Gesamtwerk jedoch bleibt stimmig. Ob seine Abrechnung mit Proust (Proust ist mein Leben), sein Jörg Fauser-likes "Wasser hat ein Gedächtnis und schlägt mir gegen die Schädelwand", sein extrem assoziativer "Salon", in dem er Entspannungspolitik auf Taschendieb reimt. Oder die John Cage-Hommage 4:33. Christian Rottler hat seinen eigenen Stil.
Man darf dem Musiker daher nur wünschen, dass er über seinen Schatten springt und das Album endlich einmal veröffentlicht. Für die Schublade ist es einfach zu schade. Doch wie formuliert es Rottler in seinem Proust-Stück selbst so schön: "Verschwendung von Talent ist auch eine Entscheidung." Schade auch, dass es seine Band Galakomplex mittlerweile nicht mehr gibt. Seine Lieder sind in dieser Form wohl nur noch auf der Platte zu hören. Zeit, dass mehr Menschen etwas davon mitbekommen.
Die Last der Freiheit
Es sind nur wenige Informationen, die aus Nordkorea nach außen dringen. Wenn wir etwas über das Land erfahren, dann meist nur, wenn die Führung dieses bitterarmen Staates wieder einmal militärisch provoziert. Dabei geht es stets um das politische Überleben dieses seltsamen Staates und seiner Führungs-Dynastie. George Friedman beschrieb diese Strategie in einer lesenswerten Analyse unlängst als ein Wechselspiel von "ferocious, weak and crazy".
Doch über die Menschen und ihren Alltag ist nur wenig bekannt. Auch eine der dunkelsten Seiten dieses Landes, sein Lagersystem, ist bisher kaum beleuchtet. Dabei existieren die Arbeitslager, in denen noch heute Hunderttausende leben, arbeiten und sterben, bereits doppelt so lang wie Stalins Gulags und zwölf mal so lang wie Hitlers KZs. Nordkoreas Führung bestreitet ihre Existenz bis heute, obwohl sie mit Google Earth inzwischen für jeden sichtbar sind.
Einem Mann jedoch, Shin Dong-Hyuk, gelang die Flucht aus einem der berüchtigsten Lager, dem Camp 14. Seine Lebensgeschichte ist mittlerweile in einer Biographie beschrieben und verfilmt worden (hier der Trailer). "Escape from Camp 14" von Blane Harden sei hiermit jedem ans Herz gelegt, der verstehen will, wie dieses sehr fremde Land funktioniert und was es mit den Menschen macht, die unter dem Regime der Kims aufwachsen und leben.
Besonders bemerkenswert ist die Geschichte dieses Mannes, weil er einer jenen Menschen ist, die in diesen Lagern geboren wurden. Eine Welt außerhalb hat er bis zu seiner Flucht nie kennengelernt. Liebe, Vertrauen, Freiheit hatte er nie erfahren. Stattdessen Zwangsarbeit, Hunger, Folter, Verrat und Mord. Seit seinem sechsten Lebensjahr musste er arbeiten - stets mit hungrigem Magen. Als 13-Jähriger musste er mit ansehen, wie Mutter und Bruder öffentlich exekutiert wurden, nachdem er deren Fluchtpläne verraten hatte. Nach den Regeln des Lagers war dies die einzig vernünftige Entscheidung. Shin Dong-Hyuk war sich sicher, die beiden hätten diese Strafe verdient. Er war nicht traurig. So etwas wie Trauer kannte er nicht. Er war wütend.
In dem gut 200 Seiten starken Buch wird aber nicht nur die so berührende wie bedrückende Vita des jungen Mannes erzählt. Der Leser erfährt auch einiges über den sonst kaum beleuchteten Alltag der Nordkoreaner, für die der Hunger ein ständiger Begleiter ist. Als Shin Dong-Hyuk von der Freiheit zu träumen beginnt, stellt er sich diese in Form von gegrilltem Fleisch vor. Etwas, das er im Lager nur zu essen bekam, wenn er heimlich Ratten jagte und dabei harte Strafen riskierte. Das Essen ist ein wichtiges Thema für den jungen Mann, dessen Leben im Lager vor allem in einem permanenten Konkurrenzkampf um die knappen, kargen Mahlzeiten bestand. Er kann sich an keinen Moment seines Lagerlebens erinnern, an dem er sich satt fühlte.
Doch nicht nur für die Menschen in den Lagern ist der Hunger Teil des Alltags. Mehr als eine Million Nordkoreaner sind in den 90er Jahren verhungert, als die Wirtschaft des Landes nach dem Untergang der Sowjetunion zusammenbrach. Und das bei einer Bevölkerung von rund 23 Millionen. Noch immer ist das Volk unterernährt, aber dank internationaler Lebensmittellieferungen (von denen nur ein Teil wirklich beim Volk ankommt) stirbt heute kaum jemand mehr daran.
Der Leser erfährt auch einiges über den Wandel, den die große Hungersnot im Land mit sich gebracht hat. Mehr Menschen sind inzwischen informiert über den Rest der Welt. Das Schauen südkoreanischer Serien und das Hören freier Radiosender ist zwar strengstens verboten, aber mittlerweile durchaus verbreitet. Es gibt im Ansatz so etwas wie freie Märkte. Diebstahl und Korruption nehmen zu. Ohne die von der Militär erzeugte Angst würde das Regime wohl kaum mehr die Kontrolle behalten. Männer müssen zehn, Frauen sieben Jahre dienen. Mit den Reservisten beträgt die Größe der Armee fünf Millionen.
Doch das Land ist noch stabil. Auch dank der von Friedman beschriebenen Strategie: Das Regime gibt sich zugleich ferocious (grimmig), weak (schwach) und crazy (verrückt). Zwischen diesen Polen schwankt die Politik des Landes nach außen. Es wirkt zu schwach, um eine wirkliche Bedrohung zu sein,
erscheint dem Zusammenbruch stets nah, gibt sich aber grimmig und
gefährlich, so dass es dennoch ernst genommen wird. Und die Führung
erweckt einen unberechenbaren, verrückten Eindruck, scheint zu allen
Opfern bereit. Eine letztlich sehr erfolgreiche Strategie.
Auch das von Kim Il Sung etabliere neofeudalistische Kastensystem trägt zur Stabilität bei. Drei Großkasten mit 51 Unterkasten gibt es in Nordkorea. Die Herrscherkaste befindet sich in und um Pjöngjang und genießt (zumindest nach nordkoreanischen Standards) außerordentliche Privilegien. Nur ihnen ist es vorbehalten Regierungs- oder Parteiarbeiten zu übernehmen. Sie besteht im Wesentlichen aus den Familien, die gemeinsam mit Kim Il Sung gegen die Japaner gekämpft haben. Die mittlere, neutrale Kaste führt ein bescheidenes Leben in begrenzter Freiheit. Der Teil der Bevölkerung, der zur untersten, feindlichen Kaste gezählt wird, darbt - oft seit Generationen in den Arbeitslagen. 1957 legte der ewige Staatschef des Landes diese Unterteilung fest. Am schlimmsten erging es dabei jenen, deren Familienangehörige in den Süden flohen oder für die japanischen Besatzer tätig waren. Über drei Generationen, so seine Ansicht, vererbe sich diese Blutschuld. Auch Shin Dong-Hyuks Familie hat solch eine Schuld auf sich geladen.
Inzwischen lebt der Nordkoreaner in Freiheit. Zumindest äußerlich. Denn das Leben und die Regeln des Lagers stecken immer noch in ihm, halten ihn weiterhin gefangen. Der Verrat an seiner Familie ist ihm erst jetzt bewusst geworden und quält. So viel Stärke der junge Mann, der in seinem kurzen Leben unfassbare Grausamkeiten erlebte, auch bewiesen hat - auf ein Leben in Freiheit hat ihn niemand vorbereitet. Die Regeln des Lagers, die über Leben und Tod entschieden, sind plötzlich nutzlos. Nach acht Jahren in Freiheit sehnt sich Shin Dong-Hyuk zurück nach Nordkorea. Er möchte wieder leben - in einem Arbeitslager.
Donnerstag, 4. April 2013
Manchmal auch bei Nacht, Marie
Deutschsprachige Musik mit anständigen Texten ist leider immer noch eine Seltenheit. Zu
sehr steckt unsere Sprache voller Fallstricke und Tücken für all jene,
die sie laut zu singen wagen. Songwriter Tristan Vox weiß mit
unserer Sprache umzugehen und verwendet sie auf seinem Debütalbum in
einem zugleich episch wie lakonisch anmutendem Sinne. Musikalisch betritt er dabei nicht unbedingt Neuland. Während seine
Stimme bisweilen an Tom Liwa, den großen Emo-Esoteriker unter den
deutschen Songwritern, erinnert, lässt er an manchen Stellen den
melancholisch-verträumten Charme von Element of Crime anklingen.
Doch seine Musik (die er komplett selbst eingespielt hat) weist über diese
Bezüge hinaus, ertönt mal sanft, mal widerspenstig, stets
dringlich. Tristan sinniert zwar mit Vorliebe
melancholisch-schwelgerisch über das Zwischenmenschliche, doch dies
mit solch kunstvoller Eleganz, dass die üblichen Vergleiche schon
recht bald überflüssig werden. Der Kontext, in dem er sich
popkulturell bewegt, funktioniert bei der Auseinandersetzung mit
diesem erstaunlichen Werk letztlich nur als Fallnetz beim
Erstkontakt. Je tiefer der Hörer in die zehn Stücke eintaucht,
desto weniger nützen diese Referenzen.
„Manchmal auch zur Nacht, Marie“
macht es dem Hörer daher gewiss nicht einfach. Hinter den oft
unscheinbar wirkenden Worten verbirgt sich eine in deutscher Sprache
selten zu vernehmende Tiefe. Trotz aller lyrischen Distanz haben wir
es hier eben keinesfalls mit einem ironischen Beobachter zu tun. Ob
der Tod des eigenen Vaters (Abendmahl) oder die fragile
Konstruiertheit des Sozialen (Wirklich) – stets findet Tristan
Vox treffende Worte, die sich schon bald ins Gedächtnis des Hörers
einbrennen. Am stärksten wirken die mehrfach codierten Zwischentöne.
So endet das Album konsequenterweise programmatisch. Und auf die von
einer Spielfigur bewusst schief gespielte Internationale folgt das
melancholische „Marie / Vielleicht“. Letztlich bleibt die Welt
fragil, die Gewissheiten, das worauf wir bauen, flüchtig. Ein
Feuer bricht aus, vielleicht.
Manchmal auch bei Nacht, Marie erscheint im Mai bei Voodokind
Manchmal auch bei Nacht, Marie erscheint im Mai bei Voodokind
Dienstag, 2. April 2013
Das Eisenbahngleichnis
Wir sitzen alle im gleichen Zug
und reisen quer durch die Zeit.
Wir sehen hinaus. Wir sahen genug.
Wir fahren alle im gleichen Zug.
Und keiner weiß, wie weit.
Ein Nachbar schläft, ein andrer klagt,
ein dritter redet viel.
Stationen werden angesagt.
Der Zug, der durch die Jahre jagt,
kommt niemals an sein Ziel.
Wir packen aus. Wir packen ein.
Wir finden keinen Sinn.
Wo werden wir wohl morgen sein?
Der Schaffner schaut zur Tür herein
und lächelt vor sich hin.
Auch er weiß nicht, wohin er will.
Er schweigt und geht hinaus.
Da heult die Zugsirene schrill!
Der Zug fährt langsam und hält still.
Die Toten steigen aus.
Ein Kind steigt aus. Die Mutter schreit.
Die Toten stehen stumm
am Bahnsteig der Vergangenheit.
Der Zug fährt weiter, er jagt durch die Zeit,
und niemand weiß, warum.
Die I. Klasse ist fast leer.
Ein feister Herr sitzt stolz
im roten Plüsch und atmet schwer.
Er ist allein und spürt das sehr.
Die Mehrheit sitzt auf Holz.
Wir reisen alle im gleichen Zug
zur Gegenwart in spe.
Wir sehen hinaus. Wir sahen genug.
Wir sitzen alle im gleichen Zug
und viele im falschen Coupé.
(Erich Kästner, 1931)
und reisen quer durch die Zeit.
Wir sehen hinaus. Wir sahen genug.
Wir fahren alle im gleichen Zug.
Und keiner weiß, wie weit.
Ein Nachbar schläft, ein andrer klagt,
ein dritter redet viel.
Stationen werden angesagt.
Der Zug, der durch die Jahre jagt,
kommt niemals an sein Ziel.
Wir packen aus. Wir packen ein.
Wir finden keinen Sinn.
Wo werden wir wohl morgen sein?
Der Schaffner schaut zur Tür herein
und lächelt vor sich hin.
Auch er weiß nicht, wohin er will.
Er schweigt und geht hinaus.
Da heult die Zugsirene schrill!
Der Zug fährt langsam und hält still.
Die Toten steigen aus.
Ein Kind steigt aus. Die Mutter schreit.
Die Toten stehen stumm
am Bahnsteig der Vergangenheit.
Der Zug fährt weiter, er jagt durch die Zeit,
und niemand weiß, warum.
Die I. Klasse ist fast leer.
Ein feister Herr sitzt stolz
im roten Plüsch und atmet schwer.
Er ist allein und spürt das sehr.
Die Mehrheit sitzt auf Holz.
Wir reisen alle im gleichen Zug
zur Gegenwart in spe.
Wir sehen hinaus. Wir sahen genug.
Wir sitzen alle im gleichen Zug
und viele im falschen Coupé.
(Erich Kästner, 1931)
Mittwoch, 20. März 2013
Samstag, 16. März 2013
Der idealistische Ur-Grüne
Wir leben in krisenhaften Zeiten. Ob in Wirtschaft und Politik oder im Umgang mit der Natur: Überall erleben wir einen dramatischen Vertrauensverlust. So zumindest die Annahme des Grünen-Urgesteins Gerald Häfner, der sich am Donnerstagabend bei einem Vortrag an der Freien Waldorfschule Engelberg auf die Suche nach den Ursachen dieser Entwicklung begab.
Gerald Häfner weiß aus der Innenansicht, wovon er spricht. Er ist Mitbegründer der Grünen, Waldorfpädagoge und Bürgerrechtler. Dreimal saß er im Bundestag, um dann immer wieder in seinen normalen Beruf zurückzukehren. Momentan ist er als Abgeordneter für die Grünen im Europaparlament. Er war bei der Gründung zahlreicher Initiativen für mehr Demokratie und Bürgerbeteiligung beteiligt. Zehn Jahre arbeitete er als Vorstandssprecher von Mehr Demokratie e.V.
Das politische Klein-Klein ist dem Münchner aus der Praxis also sehr bekannt. Doch an diesem Abend wird er grundsätzlich: „Wir wissen heute so viel, können so viel, hatten noch nie so viele Mittel, aber dennoch wird die Erde und das Leben der Menschen systematisch zerstört.“ Neben der ökologischen Krise sei das bemerkbar an einer ungemein tiefen ökonomischen, sozialen und fiskalpolitischen Krise: „Wir machen Schulden, um Schulden tragfähiger zu machen, das ist doch Irrsinn!“ Auch weil die Politik keine Zeit mehr für Grundsatzfragen habe. Entscheidungen werden immer schneller getroffen und dann als alternativlos präsentiert: „Ständig wird Feuer gelöscht, aber der Brand wird immer größer.“ Die Demokratie sieht Häfner daher in der Krise.
Das liege unter anderem am Vertrauen. Das ist für Häfner die Grundlage jeglichen menschlichen Zusammenlebens: „Ohne Vertrauen keine Entwicklung“. Doch in den vergangenen Jahrzehnten habe es eine dramatische Entwicklung gegeben. Heute gelte als dumm, wer anderen vertraue. In allen gesellschaftlichen Bereichen sei das so, nur zwei Beispiele: Während Bankbeamte einst den Kunden dienten, denke dieser heute nur noch: „Die wollen uns sicher nur was andrehen, das uns schadet.“ Und während Ärzte früher das Wohl des Patienten im Blick hatten, handelten sie heute oft aus rein ökonomischen Motiven – ganz entgegen ihres Berufsethos'.
Erstaunlich an dieser Entwicklung ist nun, dass sich eigentlich jeder bewusst sei, wie falsch er sich verhalte. „Kein Mensch will das eigentlich“. Aber alle denken, es ginge nicht anders, ganz nach dem Motto: „So läuft das Business eben.“ Als Ursache dieser Paradoxie sieht er das alle Lebenswelten durchdringende Menschenbild der Ökonomie. Danach handle der Mensch stets rational und versuche, seinen Nutzen zu maximieren. Auf dieser Annahme basiert unsere Wirtschaftsordnung. Doch stimmt sie auch?
Häfner hat da so seine Zweifel. Eine Reihe von Experimenten habe immer wieder gezeigt, dass die Menschen im Alltag keine reinen Nutzenmaximierer seien. Sie handeln sehr wohl sozial. Und er verweist auf Elinor Ostrom, die 2009 als erste Frau den Wirtschaftsnobelpreis erhielt. Sie konnte nachweisen, dass Gemeineigentum in gewissen Fällen sinnvoller und effizienter ist als Privateigentum. Vorausgesetzt alle sehen sich als Gleiche unter Gleichen an und die Nutzung ist klar geregelt.
Die Regeln unseres Zusammenlebens müssen daher auf einen neuen Boden gestellt werden, da ist sich Gerald Häfner ganz sicher. Nur als freie Vereinbarung freier und gleicher Menschen sei das möglich, „und das treibt mich wirklich um, warum wir nicht daran arbeiten“. Als einen Bösewicht macht er das Geld aus, das in den letzten Jahrzehnten ein zunehmendes Eigenleben entwickelt hat und die Köpfe der Menschen verdreht. „98 Prozent des Geldes, das zirkuliert, ist rein spekulativer Natur, ist völlig irreal. Das Animalische, von dem Waldorf-Gründer Rudolf Steiner sprach, hier ist es“.
„Nicht alles in Brüssel entscheiden“
Konkrete Ansätze, wie ein Weg aus dieser Krise aussehen könnte, bleibt Häfner an diesem Abend aber leider schuldig. Er spricht nur etwas wolkig davon, dass eine neue Form europäischer Demokratie notwendig sei. „Nicht alles sollte in Brüssel entschieden werden.“ Er plädiert für mehr direkte Demokratie. Doch in Politik und Wissenschaft sei das Misstrauen gegenüber dem Volk mittlerweile immens. Die Menschen verstünden das ja ohnehin nicht mehr, so die unausgesprochene Ansicht vieler im Politikbetrieb. Und nach den Referenden über die europäische Verfassung habe sich bei vielen EU-Politikern die Haltung eingeschlichen: „Wir sollten die Leute besser nicht mehr fragen.“
Eine fatale Haltung, wie Häfner findet. Denn oft haben Menschen mit Ideen keine Macht. Jene mit Macht aber haben allzu oft keine Ideen, sind selbst Getriebene. Das könne er jeden Tag in Straßburg beobachten. Und schließlich beweise die Schweiz ja seit gut 150 Jahren, dass direkte Demokratie möglich sein. Sachthemen statt Personen sollten viel mehr im Mittelpunkt stehen. Eine Demokratie müsse sich eben stets weiterentwickeln. Und Gerald Häfner ist sich sicher: „Die Menschen sind viel, viel weiter als die politischen Verhältnisse, in denen sie leben.“
Info:
1979 gehörte der gelernte
Waldorf-Lehrer zu den Gründern der bayerischen Grünen und ist ihnen
bis heute ebenso treu geblieben wie den Schwerpunkten seiner Arbeit:
Mehr Bürgerbeteiligung, Transparenz und Bürgerrechte. Als
Mitgründer von Mehr Demokratie e.V. berät und unterstützt er
Bügerinitiativen und agiert als Lobbyist für mehr
direktdemokratische Instrumente. Der gebürtige Münchner erhielt
mehrere Auszeichnungen, darunter 2001 das „Silberne Mikrofon“ als
bester Redner der Abgeordneten des Deutschen Bundestages und 2005 den
vom Economic Forum Deutschland vergebenen „National Leadership
Award für Politische Innovation“ in der Kategorie Verbesserung des
politischen Systems.
Donnerstag, 21. Februar 2013
Minimal China
Nachsichtigkeit ist angebracht, denn China ist musikalisch noch Entwicklungsland. In der Mao-Ära beschränkte man sich auf das Absingen von Revolutionsliedern, westliche Musik galt als dekadent und war strengstens verboten. Erst in den Achtzigern begann allmählich eine Öffnung hin zur globalen Popkultur. Doch gut 90 Prozent der chinesischen Musik besteht heute aus glattgebürstetem Pop, harmlosen Liebesliedern westlicher Prägung. Aufgrund des starken sozialen Drucks sehen es die meisten Eltern zudem nicht gerne, wenn sich ihre Kinder - abgesehen vom Erlernen des Klavier- und Geigespiels - zu viel mit Musik beschäftigen. Bildung ist alles, Musik gilt da nur als gefährliche Ablenkung. Möglichkeiten zu Konzertbesuchen sind rar, Jugendkulturen noch kaum vorhanden. Musik spielt für den Alltag der meisten Chinesen nur eine untergeordnete Rolle.
Die Doku "Minimal China" zeigt an der mehr als überschaubaren Techno-Szene des Landes exemplarisch, wie sehr die Leidenschaft für Musik jenseits von klassischer Hochkultur noch den Aussteigern vorbehalten ist und auf wie wenig Verständnis in Gesellschaft und Familie diese Pioniere hoffen können.
Mittwoch, 20. Februar 2013
Montag, 4. Februar 2013
Eine Inszenierung von Normalität
Im Kernland der Liberalen hatte sich am Sonntag ein liberaler Hoffnungsträger angekündigt. Der schleswig-holsteinische Fraktionsvorsitzende Wolfgang Kubicki gab den Seelentröster und plädierte selbstbewusst für eine Wiederbelebung der liberalen Idee.
Von der wohl schwersten Krise in der Geschichte der FDP ist an diesem Sonntagmorgen wenig zu spüren. In Fellbach lebt es noch, das liberale Bürgertum. Doch ein Bedürfnis an Zuspruch ist beim traditionellen Neujahrsempfang auch hier deutlich zu spüren. Und niemand könnte dieses trotzige Beharren wohl gerade besser verkörpern als der Norddeutsche und alles andere als kühle Querdenker Kubicki.
Doch bevor der Stargast seine Ermunterungsrede halten darf, ist es an der lokalen Politprominenz, den Gästen - und sich selbst - Selbstbewusstsein zuzusprechen. Der Kreistagsabgeordnete Ulrich Lenk etwa kritisiert den Hang zur Selbstinszenierung mancher Parteikollegen mit harten Worten: „Man muss auch mal die Klappe halten, anstatt Parteikollegen öffentlich madig zu machen.“ Und der Fellbacher OB Christoph Palm verweist stolz auf das liberale schwäbische Bürgertum, das schon immer nach dem Motto lebe: „Müßiggang ist uns fremd.“
Auch der Bundestagsabgeordnete Hartfrid Wolff sieht die Aussichten für seine Partei vor der Bundestagswahl optimistisch: „Das liberale Milieu ist da und lebt.“ Er verweist auf die Rolle der FDP als Anwalt der Steuerzahler im Rahmen der Euro-Krise und äußert sich in Richtung des politischen Gegners: „Eine Gesellschaft lässt sich alleine mit Dagegensein nicht zusammenhalten.“
Fundamentalkritik an der grün-roten Landesregierung
Ex-Innenminister und Landtagsabgeordneter Ulrich Goll schließlich übt Fundamentalkritik an der grün-roten Landesregierung, die mit den pragmatischen Landes-Traditionen breche und praktisch auf keinem Politikfeld etwas zu Wege brächte. Sei es die Bildungs-, die Wirtschafts- oder auch die Integrationspolitik: Überall vermisse er Impulse und sehe allenthalben Politik, die sich auf die falschen Prämissen stütze. Mit Blick auf die Neuverschuldung mahnt er gar: „Das ist der Weg nach Griechenland!“
Nach einer Stunde Vorspiel betritt dann Kubicki die Bühne. In schnellen Stakkato-Sätzen spricht er abschätzig über all jene, die seine FDP auf dem absteigenden Ast sehen. „Wenn Sie Forsa-Aktien haben, verkaufen Sie sie“, rät er im Hinblick auf die schlechten Umfragewerte, die den Wahlerfolgen in Schleswig-Holstein, Nordrhein-Westfalen und unlängst Niedersachsen vorausgingen. Bei der kommenden Bundestagswahl, äußert er siegessicher, werde wieder dasselbe passieren.
Der für seine markigen Sprüche bekannte Politiker, der sich anschickt, beim nächsten Parteitag ins FDP-Präsidium gewählt zu werden, lässt kein gutes Haar an der herrschenden politischen Kultur. Die Political Correctness führe dazu, dass nur noch denunziert werde, anstatt über Sachthemen zu sprechen.
Bestes Beispiel: Die aktuelle Sexismus-Debatte, die ihm „mächtig auf den Senkel geht“. Denn auch hier werde nur wieder über Personen und nicht die Sache diskutiert. Und wenn er mit seinen 60 Jahren aus der Zeit gefallen erscheine, dann sei das eben so: „Ich werde auch in Zukunft einer Frau in den Mantel helfen - und gegebenenfalls auch wieder hinaus.“ Der vor allem bei den Grünen vorherrschende Erziehungsgedanke und das Moralisieren sei ihm zuwider: „Das Gegenteil von gut ist eben gut gemeint“. Wie übrigens alle seine Vorreder verurteilt er „rot-grüne Staatsgläubigkeit und Verschuldungspolitik“ und schreibt seinem alten Studienkollegen Peer Steinbrück ins Stammbuch: „Der Staat ist nicht der bessere Akteur im Wirtschaftsleben.“
Genüsslich zitiert er aus dem letzten Buch des SPD-Kanzlerkandidaten, dem er eine hohe finanzpolitische Kompetenz attestiert und kontrastiert diese Aussagen mit den aktuellen Forderungen der SPD. Egal ob Steuern, Europapolitik oder die Haltung zur Agenda 2010: Überall verabschiede sich Steinbrück von seinen Grundhaltungen. „Dass sie sich davon verabschieden, wird der SPD massiv auf die Füße fallen.“
Ein Traum: Die Vereinigten Staaten von Europa
Wolfgang Kubicki plädiert für eine klare pro-europäische Haltung der Liberalen: „Wenn wir auch künftig weltweit Regeln nach europäischen und nicht konfuzianischen Werten durchsetzen wollen, gelingt das nur mit der EU.“ Es könne kein Zurück geben, sondern nur ein Mehr an Integration: „Wir brauchen die Vereinigten Staaten von Europa.“
Das hieße nicht nur, mehr Parlamentarismus und Kontrolle zu fordern, sondern auch Solidarität mit den Griechen zu üben, sie gar in unser Land einzuladen: „Griechen, kommt zu uns. Wir leben alle in einem gemeinsamen europäischen Haus.“
Die FDP sei aber vor allem eine Rechtsstaatspartei. Gleichheit vor dem Gesetz solle daher auch für Großunternehmen und systemrelevante Banken gelten. Die Verlagerung von Haftung im Rahmen der Finanzkrise sei daher abzulehnen. Wenn Banken schlecht wirtschaften, hätten sie eben zu schrumpfen: „Ich will nicht in einem Staat leben, in dem Hedgefonds auf Staaten wetten. Das gehört verboten!“
Diesem für Liberale eher ungewöhnlichen Appell folgt am Ende der Rede die Betonung des sozialen Charakters der FDP. „Im sozialen Elend kann keine Freiheit wachsen, das wusste schon Friedrich Naumann.“ Doch Sozialpolitik, da gibt sich Kubicki wieder klassisch liberal, könne nur durch das ehrenamtliche Engagement der Bürger errungen werden. Die Verantwortung liege bei den Leistungsfähigen. Eine Botschaft, die gut ankommt beim liberalen Publikum, das den Stargast für seinen komplett frei gehaltenen Vortrag mit lang anhaltendem Beifall belohnt.
Abonnieren
Posts (Atom)